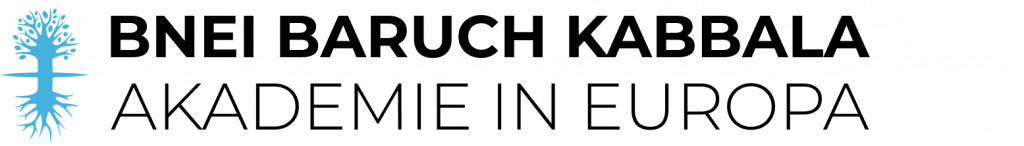Einsamkeit tötet

Vor einigen Tagen hatte sich ein junger Mann in Israel, ein Schullehrer, getötet. Er hatte Schüler, er hatte eine Anstellung, er war gesund, gut aussehend, wortgewandt und er war einsam. In einem Facebook-Post schrieb er seine letzte Mitteilung: „Es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein; Einsamkeit tötet. Ein weiterer Tag, eine weitere Woche, ein weiterer Monat, ein weiteres Jahr vergeht und ich bin allein. Mittags, bei der Arbeit, abends, an Wochenenden, an Feiertagen und an Geburtstagen, an die sich niemand erinnert. Die wenigen Freunde sind gegangen, im Laufe der Zeit verblasst; es ist Zeit zu gehen“.
Dieser Mann war nicht der einzige mit solchen Gefühlen. Seine Worte in den sozialen Medien erfassen den Fluch unserer Zeit: Wir sind alle miteinander verbunden und doch so einsam. Die Einsamkeit ist in diesen Tagen gerade deshalb so stark geworden, weil wir eigentlich so viel mehr miteinander verbunden sein müssten, als wir es sind.
Wir sind in unserer Entwicklung so spät dran. Inzwischen hätten wir eine verbundene Menschheit sein müssen, die fühlt, dass sie ein ganzheitliches System ist, dessen Teile einander ergänzen und miteinander korrespondieren, zum Wohle der Menschheit und der gesamten Natur. Stattdessen sind wir bis vor kurzem bis zum Hals in den Sumpf der gegenseitigen Zerstörung eingetaucht, den wir stolz (und fälschlicherweise) als „kapitalistische Wirtschaft“ und „Fortschritt“ bezeichnet haben.
Als plötzlich Covid-19 auftauchte und uns zwang, eine Pause in der gegenseitigen Vernichtung einzulegen, fingen wir an die Leere zu spüren, die wir in uns tragen. Aber was könnten wir sonst noch in uns tragen? Wenn jeder jeden hasst und sich vor jedem anderen so sehr fürchtet, dass man aufhört zu sprechen und sich nur noch per SMS verständigt. Wenn man um sich herum Mauern aus falschem Selbstvertrauen und falschem Lächeln errichtet, um die eigene Unsicherheit zu verbergen.
Wenn man plötzlich allein ist, wird einem klar, dass man keine Ahnung hat, wer man ist, wie man zu sich selbst stehen kann oder was man wirklich will. Der Grund ist, dass man sein ganzes Leben lang damit beschäftigt war, Mauern gegen die feindliche Außenwelt zu errichten. Und niemand ruft an, weil sie alle in der gleichen Situation sind: Alle sind einsam und haben Angst davor, verletzt zu werden.
Einsam zu sein bedeutet, dass man ignoriert wird, dass sich die Menschen nicht um einen kümmern, so dass manche Menschen es vorziehen, ihr Leben zu beenden, bis es irgendwann, auch wenn es ihr letzter Moment ist, es doch jemanden kümmert.
Warum wir uns nicht verbinden können?
Die Menschheit unterscheidet sich von allen anderen Teilen der Natur dadurch, dass sie sich aus eigenem Antrieb entwickeln muss. Im Vergleich zu anderen Lebewesen ist unsere Evolution weitaus weniger physisch, sondern eher emotional, intellektuell und sozial. Auf dem Höhepunkt unserer Evolution sind wir dazu bestimmt, die Ganzheit des Systems zu erfahren, das wir „Universum“ nennen.
In der menschlichen Gesellschaft müssen wir, ebenso wie ein menschliches Kleinkind, Schritt für Schritt lernen, wie wir soziale Wesen werden und wie wir eine gute Gesellschaft füreinander aufbauen können.
Die Natur entwickelt alle anderen Elemente, außer der Menschheit, durch Instinkte. Dem Menschen fehlen sie weitgehend. Wenn ein Tier geboren wird, weiß es sofort, wo es Nahrung findet, kann oft innerhalb weniger Stunden laufen und verhält sich im Allgemeinen wie jedes andere Tier seiner Art. Der Mensch hingegen kann bei der Geburt seine Hände und Beine kaum bewegen und bleibt über Jahre hinweg völlig hilflos. Im Gegensatz zu Tieren muss sich der Mensch sein Wissen durch harte Arbeit selbst erarbeiten. In der menschlichen Gesellschaft müssen wir, genau wie ein menschliches Kleinkind, Schritt für Schritt lernen, wie wir soziale Wesen werden und für uns eine gute Gesellschaft schaffen können. Wir entwickeln uns durch unseren eigenen Wunsch, unsere Situation zu verbessern. Und wir entwickeln uns nicht willkürlich, sondern in eine klare Richtung: hin zu mehr Zusammenhalt, zu mehr Fürsorge füreinander, zu mehr gegenseitiger Verantwortung und schließlich zu mehr Liebe füreinander.
Wenn ein Kind hungrig ist, weint es, weil sich ein leerer Magen schlecht anfühlt. Wenn ein Mensch einsam ist, weint er, weil sich ein leeres Herz überaus schlimm anfühlt. Herzschmerz tut viel mehr weh als ein leerer Magen.
Aber die Einsamkeit, die so Viele heute empfinden, ist nicht das Ende. Es ist der Anfang. Es ist die Dunkelheit vor der Morgendämmerung. Jetzt beginnen wir zu erkennen, dass wir alles und vor allem unsere Beziehungen verändern müssen. Um etwas zu verändern, müssen wir das Gefühl haben, dass die Gegenwart unerträglich ist. Und nichts ist unerträglicher als Einsamkeit.
Wir können solche Tragödien wie Selbstmord aus Einsamkeit verhindern, wenn wir aufhören, auf eine Rückkehr zu unserem früheren, rückständigen Zustand der „freien“ Wirtschaft zu beharren, der von Egoismus beherrscht wird. Und wir müssen anfangen, in den Zustand der gegenseitigen Anteilnahme und Empathie zu kommen, indem wir uns schon längst hätten befinden sollen. Auf dem Weg dorthin werden wir erkennen, dass es nicht nur besser ist füreinander zu sorgen, als sich voreinander zu fürchten, sondern auch wie die ganze Realität außer uns funktioniert, bis auch wir diesen Zustand erreichen.
Bild von Kleiton Santos auf Pixabay
 Diesen Beitrag drucken
Diesen Beitrag drucken






 RSS Feed abonnieren
RSS Feed abonnieren